Последнее обновление статьи 02.09.2025
Katzen sind geheimnisvolle, elegante Tiere, die uns mit ihrer Unabhängigkeit und Zuneigung gleichermaßen verzaubern. Doch hinter dem samtenen Fell können sich Krankheiten verbergen, die schnell ernst werden. In diesem Artikel nehme ich Sie mit auf eine ausführliche Reise durch die häufigsten Katzenkrankheiten – von FLUTD (Feline Lower Urinary Tract Disease) bis zur CNI (chronische Nierenerkrankung). Dabei gehe ich nicht nur auf Symptome ein, sondern erkläre verständlich Ursachen, Diagnostik, Behandlungsmöglichkeiten, Vorbeugung und typische Fallstricke, die sogar erfahrene Katzenhalter überraschen können. Dieser Leitfaden ist lebendig geschrieben, leicht verständlich und soll Ihnen helfen, Ihre Katze besser zu beobachten und im Ernstfall schneller zu reagieren.
Warum Wissen um Katzenkrankheiten so wichtig ist
Katzen sind Meister im Verbergen von Schwäche. Instinktsicher verschleiern sie Schmerzen und Unwohlsein, weil in der Wildbahn ein Zeichen von Schwäche gefährlich wäre. Deshalb ist es für Halter besonders wichtig, subtile Veränderungen im Verhalten, Appetit oder im Toilettenverhalten früh zu bemerken. Früherkennung kann oft den Unterschied zwischen einer unkomplizierten Behandlung und langwierigen, kostspieligen Therapien machen.
Praktisch bedeutet das: Beobachten Sie Ihre Katze täglich. Achten Sie auf Fress- und Trinkverhalten, die Häufigkeit und Beschaffenheit der Ausscheidungen, Fellzustand, Aktivitätslevel und das Sozialverhalten. Kleine Veränderungen sind oft erste Alarmsignale, die bei genauerer Beobachtung einen Krankheitsprozess entlarven können. Dieser Artikel liefert Ihnen das notwendige Hintergrundwissen, damit Sie diese Signale richtig deuten.
Ein strukturierter Überblick: Welche Krankheiten sind typisch?
Der Begriff „typische Katzenkrankheiten“ umfasst ein breites Spektrum. Manche Erkrankungen sind altersabhängig (z. B. CNI bei älteren Katzen), andere sind spezifisch für Rasse, Haltung oder Ernährung. Im Folgenden ein strukturierter Überblick, bevor wir tiefer in die Einzelheiten gehen.
Tabelle 1: Häufige Katzenkrankheiten auf einen Blick
| Nr. | Erkrankung | Typische Altersgruppe | Hauptsymptome | Kurzinfo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUTD (untere Harnwegserkrankungen) | Alle – häufig bei jungen bis mittleren Katzen | Stranges Verhalten beim Urinieren, Blut im Urin, vermehrter oder vermindeter Toilettengang | Viele Ursachen: Struvit, Idiopathisch, Urolithen, Infektionen |
| 2 | CNI (chronische Nierenerkrankung) | Ältere Katzen | Gewichtsverlust, vermehrtes Trinken, schlechtes Fell, Erbrechen | Langsam fortschreitend, oft erst spät bemerkt |
| 3 | FIP (Feline infektiöse Peritonitis) | Sowohl jung als auch alt (häufig jung) | Appetitlosigkeit, Fieber, Bauchwassersucht, neurologische Zeichen | Ursache: Coronavirus-Mutation; schwierig, oft tödlich |
| 4 | FIV / FeLV (Immunsuppression) | Alle Altersgruppen | Wiederkehrende Infektionen, Gewichtsverlust, Lymphknotenschwellung | Virale Erkrankungen mit langfristigen Folgen |
| 5 | Diabetes mellitus | Mittlere bis ältere Katzen; oft übergewichtige Tiere | Vermehrtes Trinken, vermehrter Urinabsatz, Gewichtsverlust | Insulinabhängige Erkrankung, Management durch Ernährung & Medikamente |
Jede dieser Erkrankungen verdient eigene Aufmerksamkeit. Ich beginne mit FLUTD und CNI, weil sie im Titel genannt sind, und erläutere dann weitere relevante Krankheiten und Aspekte rund ums Katzenwohl.
FLUTD – Die untere Harnwegserkrankung
FLUTD ist kein einzelnes Leiden, sondern ein Sammelbegriff für verschiedene Probleme der Blase und Harnröhre. Das reicht von einfachen Blasenentzündungen bis zur gefährlichen Harnröhrenverlegung, die bei männlichen Katzen lebensbedrohlich sein kann. Besonders gefährlich sind Fälle, in denen sich Harnsteine oder Schleimpfropfen bilden und die Harnröhre blockieren.
Die Symptome können subtil beginnen: Katze «klingt» beim Urinieren, sitzt häufig in der Katzentoilette, produziert nur kleine Mengen Urin oder versucht oft zu urinieren ohne Erfolg. Blut im Urin, Schmerzen beim Berühren des Bauches und allgemeine Unruhe sind weitere Warnzeichen. Manche Katzen zeigen auch vermehrtes Belecken des Genitalbereichs oder meiden die Toilette komplett.
Ursachen und Risikofaktoren
FLUTD kann durch mehrere Ursachen entstehen. Eine grobe Einteilung:
- Idiopathische Zystitis (ohne klare Ursache, häufig stressassoziiert)
- Urolithiasis (Harnsteine aus Struvit oder Kalziumoxalat)
- Bakterielle Infektionen (seltener bei jungen Katzen, häufiger bei älteren/diabetischen Tieren)
- Harnröhrenobstruktion (meist männliche Kater)
- Neoplasien oder anatomische Anomalien
Stress, falsche Ernährung (trockenfutterdominant, wenig Trinken), Übergewicht und Wassermangel sind große Risikofaktoren. Kastrierte Kater scheinen aufgrund der engeren Harnröhre empfindlicher gegenüber Verlegungen.
Diagnostik und Sofortmaßnahmen
Die Diagnostik umfasst Urinuntersuchung, Blutwerte, eventuell Röntgen oder Ultraschall. Bei Verdacht auf Obstruktion ist rasches Handeln lebenswichtig: Eine verlegte Harnröhre kann zu Nierenversagen, Hyperkaliämie und Tod führen. Bei akuten Notfällen darf nicht gezögert werden, eine Tierklinik aufzusuchen.
Praxisnahe Punkte:
- Sofortige klinische Untersuchung und Harnblasenentleerung (Zystozentese oder Katheterisierung).
- Blutuntersuchung zur Beurteilung von Elektrolyten (Kalium!), Nierenwerten und Entzündungszeichen.
- Langfristig: Ernährungsumstellung, Stressreduktion, Verhaltenstherapie.
Therapie und Prävention
Die Behandlung richtet sich nach Ursache: Antibiose bei bakteriellen Infektionen, Diät und vermehrte Wasserzufuhr bei Struvit- oder idiopathischer Zystitis, operative Maßnahmen bei Tumoren. Besonders wichtig ist die Prävention: ausreichend Trinkmöglichkeiten, feuchte Nahrung, mehrere saubere Toilettenplätze, Stressreduktion und ggf. Zusatzmaßnahmen wie Pheromon-Diffusoren.
Eine kleine Liste mit praktischen Tipps:
- Stellen Sie mehrere Katzentoiletten an ruhigen Orten auf.
- Bieten Sie Nassfutter an und ermuntern Sie zum Trinken (Wasserbrunnen, verschiedene Wassernäpfe).
- Reduzieren Sie Stressoren: neue Tiere, Umzüge, laute Bauarbeiten – alles kann FLUTD begünstigen.
CNI – Chronische Nierenerkrankung bei Katzen
Die chronische Nierenerkrankung ist eine der häufigsten Todesursachen älterer Katzen. Sie entwickelt sich schleichend über Monate bis Jahre und wird oft erst in fortgeschrittenen Stadien erkannt. Nieren sind über Jahrzehnte belastbar, doch wenn ein kritischer Prozentsatz verloren geht, beginnt ein zunehmender Funktionsverlust.
Erste Anzeichen sind oft unspezifisch: vermehrtes Trinken und Urinieren, Gewichtsverlust, Appetitverlust, mattes Fell und vermehrtes Erbrechen. Auffällig ist, dass viele Katzen trotz erheblicher Nierenschädigung noch ein normales Verhalten zeigen – daher müssen Besitzer aktiv auf subtile Veränderungen achten.
Pathophysiologie und Ursachen
CNI kann durch viele Ursachen entstehen: Altersdegeneration, wiederholte Nierenschäden durch Infektionen, Harnwegsobstruktionen, Toxine (z. B. Rattengift, bestimmte Pflanzen), genetische Dispositionen (bei bestimmten Rassen) oder als Folge anderer systemischer Erkrankungen wie Hyperthyreose oder Diabetes.
Die Nieren verlieren Nephrone, die verbleibenden übernehmen zusätzliche Arbeit, was langfristig zu Hyperfiltration, Proteinurie und noch schnellerem Funktionsverlust führen kann. Ein früher diagnostischer Anhaltspunkt ist das Vorhandensein von Protein im Urin.
Diagnostik
Die Diagnostik umfasst wiederkehrende Blutuntersuchungen (Kreatinin, Harnstoff, Elektrolyte), Urinuntersuchung (USG – spez. Gewicht; Proteinurie) und Bildgebung (Ultraschall). Moderne Diagnostik nutzt auch SDMA (Symmetric Dimethylarginine) als früheren Marker für Nierenschädigung, noch bevor Kreatinin steigt.
Wichtige diagnostische Schritte sind:
- Anamnese und klinische Untersuchung.
- Blutwerte und Urinanalyse (inkl. Sediment, Protein/Creatinin-Verhältnis).
- Ultraschall zur Beurteilung der Nierengröße und Struktur.
Behandlung und Langzeitmanagement
CNI ist in den meisten Fällen nicht heilbar, aber gut behandelbar. Ziel ist, den Fortschritt zu verlangsamen, Symptome zu lindern und die Lebensqualität zu erhalten. Wichtige Maßnahmen:
- Ernährungsumstellung auf Nierendiät (reduzierter Proteingehalt, angepasstes Phosphor).
- Kontrolle von Blutdruck und Elektrolyten; Behandlung von Hypertonie.
- Therapie von Begleiterkrankungen (z. B. Infektionen, Hyperthyreose).
- Flüssigkeitszufuhr erhöhen (Subkutane Infusionen können zuhause gelernt werden).
- Regelmäßige Kontrollen: Blut und Urin alle 3–6 Monate oder bei Verschlechterung.
Wichtig zu betonen: Subkutane Flüssigkeitsgabe sollte immer in Absprache mit und nach Einweisung durch den Tierarzt erfolgen. Viele Katzenhalter berichten, dass diese Maßnahme die Lebensqualität ihrer Katzen deutlich steigert.
Weitere wichtige Krankheiten und warum sie relevant sind
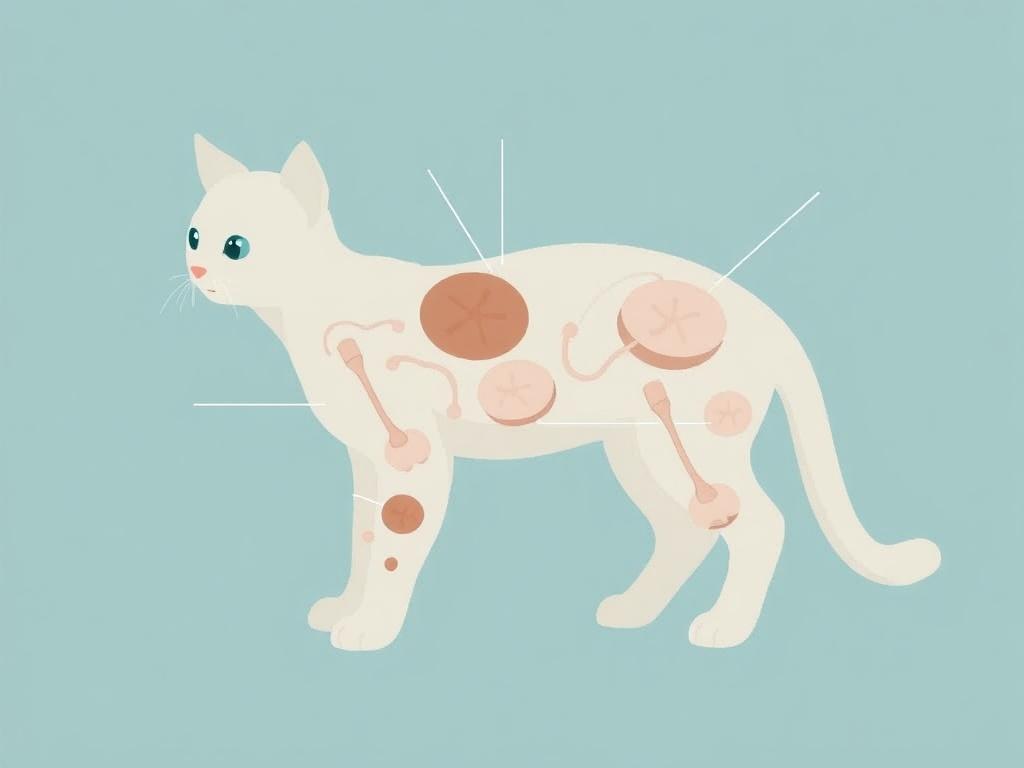
Neben FLUTD und CNI gibt es eine Reihe weiterer Krankheiten, die Katzen häufig betreffen und die jeder Halter kennen sollte. Ich stelle einige kurz vor und gehe auf typische Warnsignale ein.
FIP – Feline infektiöse Peritonitis
FIP wird durch eine Mutation eines weitverbreiteten Katzen-Coronavirus ausgelöst. Nicht alle infizierten Katzen entwickeln FIP – die Erkrankung tritt meist bei immunsupprimierten oder jungen Katzen auf. Typische Zeichen sind wiederkehrendes Fieber, Appetitlosigkeit, Bauchwassersucht (feuchte Form) oder neurologische Symptome (trockene Form). Die Prognose war lange Zeit schlecht, aber neuere antivirale Behandlungen haben die Perspektive verändert; allerdings sind sie teuer und nicht immer verfügbar.
FIV / FeLV
FIV (Feline Immunodeficiency Virus) und FeLV (Feline Leukämievirus) sind Viruserkrankungen, die das Immunsystem schwächen. Testergebnisse beeinflussen Zucht- und Haltungsentscheidungen: Infizierte Katzen benötigen spezielle Betreuung, können aber mit guter Pflege oft lange leben. Wichtig: Impfung gegen FeLV ist verfügbar und sinnvoll bei Freigängern oder Mehrkatzenhaushalten mit Risiko.
Diabetes mellitus
Diabetes äußert sich durch gesteigerten Durst, häufigen Urinabsatz und Gewichtsverlust. Häufig ist Übergewicht ein Risikofaktor. Therapie besteht in Diätumstellung und häufig Insulintherapie; viele Katzen können mit gutem Management lange Lebensqualität behalten. Früherkennung ist wichtig, weil schwere Stoffwechselentgleisungen lebensbedrohlich sein können.
Hyperthyreose
Hyperthyreose ist bei älteren Katzen sehr verbreitet und zeigt sich durch gesteigerten Appetit bei Gewichtsverlust, Unruhe, vermehrtes Trinken und Erbrechen. Die Diagnose erfolgt durch Bluttests. Die Behandlungsmöglichkeiten reichen von Medikamenten über Radiojodtherapie bis zur diätetischen Kontrolle.
Haut- und Parasitenprobleme
Milben, Flöhe, Allergien und Pilzinfektionen sind häufig. Hautprobleme führen oft zu Juckreiz, kahlen Stellen oder entzündeten Hautarealen. Flöhe können zudem allergische Reaktionen auslösen (FAD – Flohallergische Dermatitis). Früherkennung und konsequente Parasitenprophylaxe sind wichtig – sowohl für die Katze als auch für den Menschen im Haushalt.
Diagnostische Werkzeuge – verständlich erklärt
Bei der Abklärung von Krankheitszeichen nutzt der Tierarzt eine Reihe von Werkzeugen. Es hilft als Halter zu wissen, was geprüft wird und warum.
Wichtige diagnostische Tests
- Blutbild und Biochemie: Basis zur Einschätzung von Organfunktionen (Niere, Leber), Entzündungsparametern und Elektrolyten.
- Urinuntersuchung: Harnsediment, pH, spezifisches Gewicht, Proteinuria – besonders wichtig bei Harnwegserkrankungen und CNI.
- Ultraschall: Bildgebung von Bauchorganen, Nieren und Blase; gut zur Darstellung von Tumoren oder Harnsteinen.
- Röntgen: Zur Detektion radioaktiver Harnsteine und zur allgemeinen Beurteilung des Brust- oder Bauchraums.
- Spezielle Tests: SDMA (für frühe Nierenschädigung), FeLV/FIV-Tests, Schilddrüsendiagnostik (T4).
Die Kombination von Anamnese (genauer Krankengeschichte), klinischer Untersuchung und zielgerichteten Tests ergibt ein aussagekräftiges Bild. Vertrauen Sie darauf, dass Tierärzte oft mehrere Diagnostikschritte benötigen, um Klarheit zu gewinnen.
Praktische Tipps für den Alltag: Prävention, Ernährung und Verhalten
Vorbeugen ist oft einfacher als Heilen. Einige Maßnahmen können Risiko deutlich senken und die Lebensqualität Ihrer Katze verbessern. Es ist erstaunlich, wie viel Einfluss Haltung und kleine Verhaltensänderungen haben können.
Empfehlungen zur Prävention
- Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen (mind. einmal jährlich, ab dem Seniorenalter öfter).
- Gesunde Ernährung: Hochwertiges Futter, angepasste Kalorienzufuhr, Nassfutter zur Hydratation.
- Gewichtskontrolle: Übergewicht ist Risikofaktor für Diabetes, Gelenkprobleme und Herzkrankheiten.
- Impfschutz und Parasitenprophylaxe: Schutz vor FeLV, Tollwut (je nach Region) und inneren/äußeren Parasiten.
- Stressreduktion: Rückzugsorte, regelmäßige Spielzeiten, Pheromondiffusoren bei Mehrkatzenhaushalten.
Besonders bei FLUTD und CNI zahlen sich Maßnahmen wie Nassfutterfütterung, ausreichende Trinkmöglichkeiten und regelmäßige Kontrollen aus. Kleine Schritte im Alltag haben oft große Wirkung.
Wann ist es ein Notfall? Alarmzeichen, bei denen Sie sofort handeln sollten
Manche Symptome dürfen nicht abgewartet werden. Wenn Sie eines der folgenden Alarmzeichen beobachten, suchen Sie sofort einen Tierarzt oder eine Tierklinik auf.
Notfall-Warnzeichen (Tabelle 2)
| Nr. | Symptom | Warum dringend? |
|---|---|---|
| 1 | Unfähigkeit zu urinieren / ständige Versuche ohne Erfolg | Harnröhrenverlegung kann zu lebensbedrohlicher Hyperkaliämie führen |
| 2 | Starke Atemnot | Kann Herz- oder Lungenprobleme anzeigen, rasches Handeln nötig |
| 3 | Stumpfe Bewusstseinsveränderung / Krampfanfälle | Neurologische Notfälle oder Stoffwechselentgleisungen |
| 4 | Extremer Schmerz, starker Blutverlust | Notwendigkeit unmittelbar tierärztlicher Behandlung |
Zögern Sie nicht, im Zweifel anzurufen – Tierärzte geben oft telefonisch Ersteinschätzungen und können entscheiden, ob ein sofortiges Kommen nötig ist.
Fallstricke und Mythen: Was nicht stimmt
Es gibt viele Mythen rund um Katzenkrankheiten. Einige sind gefährlich, andere harmlos, aber irreführend. Hier einige Klarstellungen:
- „Katzen sollten wenig Wasser trinken“ – falsch. Katzen brauchen ausreichend Flüssigkeit; Nassfutter ist oft sinnvoll.
- „Diät hilft immer sofort“ – Diät ist wichtig, aber nicht jede Katze reagiert gleich; tierärztliche Begleitung nötig.
- „Wenn die Katze frisst, geht es ihr gut“ – nicht zwangsläufig; Katzen fressen oft trotz Krankheit.
Wichtig ist kritisches Hinterfragen und Austausch mit dem Tierarzt. Holen Sie eine zweite Meinung ein, wenn Sie unsicher sind.
Checkliste für den Tierarztbesuch
Ein strukturierter Besuch spart Zeit und verbessert die Diagnostik. Bringen Sie folgende Informationen und Materialien mit:
- Aktuelle Futterangaben (Marke, Sorte, Menge)
- Medikationsübersicht (falls vorhanden)
- Veränderungen im Verhalten, Fress- und Toilettenprotokoll (ggf. mit Zeitangaben)
- Urinstreifen oder frische Urinprobe, wenn möglich
Diese Informationen helfen dem Tierarzt, rasch eine gezielte Diagnostik zu planen.
Worauf Sie sich einstellen sollten: Kosten & Zeit
Manche Diagnosen und Therapien sind kostenlos, andere können deutlich kostenintensiver sein. Notfallbehandlungen, bildgebende Diagnostik, spezielle Laboruntersuchungen und langfristige Therapien (z. B. Insulin, Nierendiät) verursachen Kosten. Planen Sie deshalb eine Rücklage ein oder erkundigen Sie sich nach Versicherungslösungen für Ihr Haustier. Bedenken Sie auch Zeitaufwand: Regelmäßige Kontrollen, Medikamentengaben und ggf. subkutane Flüssigkeitsgaben brauchen Routine und Geduld.
Ressourcen und Unterstützung für Katzenhalter
Es gibt vielfältige Hilfestellungen: Tierärzte, spezialisierte Katzenkliniken, Tierschutzorganisationen, Online-Foren und Fachliteratur. Achten Sie auf seriöse Quellen (Tierkliniken, Universitätskliniken, anerkannte Fachbücher oder Tierärzte) und vermeiden Sie dubiose „Wundermittel“. Der Austausch mit anderen Haltern kann unterstützend sein, ersetzt aber nicht die fachliche Beratung.
Schlussfolgerung
Die Welt der Katzenkrankheiten ist groß und manchmal beängstigend, doch mit Wissen, aufmerksamer Beobachtung und gutem Kontakt zum Tierarzt lassen sich viele Probleme früh erkennen und erfolgreich behandeln. Achten Sie auf subtile Veränderungen, bieten Sie Ihrer Katze eine stressarme Umgebung und eine geeignete Ernährung, und zögern Sie nicht, bei Alarmzeichen sofort tierärztliche Hilfe zu suchen. Gute Vorsorge und regelmäßige Kontrollen sind das A und O, um Ihrer Katze ein langes, gesundes und glückliches Leben zu ermöglichen.






